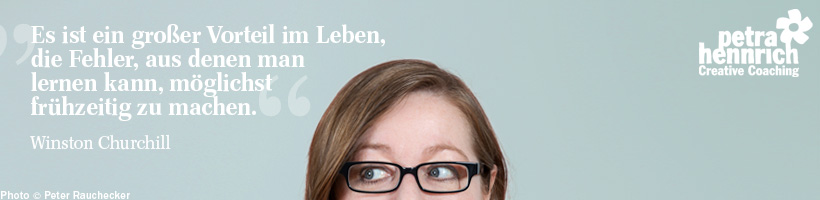
Toll, ein Anderer macht's!

In Yagan, einer der Sprachen der Eingeborenen von Feuerland, bedeutet das Wort "mamihlapinatapai": "Jeder erwartet von jemand anderem, dass dieser etwas tut, was alle wünschen, aber keiner bereit ist zu tun."
Auch in unserem modernen deutschen Sprachgebrauch, so unken einige, gäbe es eine vergleichbare Vokabel: "Team" - das Akronym für "Toll-ein-anderer-macht's". So weit möchte ich nicht gehen, denn ich habe schon in einigen sehr guten Teams gearbeitet, in denen die "mamihlapinatapai"-Mentalität nicht verbreitet war.
Dennoch: das Prinzip hinter dieser Art der Arbeitsvermeidung ist wohl allseits bekannt, und jede/r Leser/in wird unschwer Beispiele aus dem eigenen Alltag finden, in denen es zur Anwendung kam und kommt. Ein Lehrbuchbeispiel ist der Fall einer jungen Frau in New York vor einigen Jahrzehnten, die vor den Augen von 38 Zeugen ermordet wurde. Keiner der Zeugen, die die Tat vom Fenster ihrer Wohnung aus beobachten konnten, leistete Hilfe oder griff auch nur zum Telefon, um die Polizei zu rufen.
Die Fachwelt spricht von Verantwortungsdiffusion, wenn - wie in diesem tragischen Fall - jeder Zeuge eines Vorfalls von einem anderen Beobachter erwartet, dass dieser sich die Mühe macht, Hilfe zu leisten. Anders ausgedrückt: "Je größer die Zahl der Zuschauer (n) in einer Hilfeleistungssituation, desto geringer ist die (individuelle) Wahrscheinlichkeit (p), dass eine bestimmte Person Hilfe leistet."
Diese Je-desto-Hypothese wurde in zahlreichen experimentellen Settings geprüft und gilt bislang als unwiderlegt. Im sogenannten "Freiwilligendilemma" wurde sie auch von Vertretern der Spieltheorie aufgegriffen und verallgemeinert. Neben der Gruppengröße n, die wir schon oben erwähnt haben, führt die Spieltheorie noch die Faktoren U für den kollektiven Wert der Tätigkeit und K für die (individuellen) Kosten an. Die zugehörige mathematische Formel des spieltheoretischen Modells erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Die (experimentell reproduzierbare) Kernaussage ist jedenfalls: Die Wahrscheinlichkeit der Kooperation steigt mit dem Wert U, sinkt mit den Kosten K und mit der Gruppengröße n.
Vielleicht lässt sich diese Formel auch mit Gewinn auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihren Umgang mit Schutz suchenden Menschen anwenden?
Welche "mamihlapinatapai"-Situationen fallen Ihnen ein?
Rufen Sie mich an!
Literatur: Diekmann, Andreas. 2010. Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt
Dennoch: das Prinzip hinter dieser Art der Arbeitsvermeidung ist wohl allseits bekannt, und jede/r Leser/in wird unschwer Beispiele aus dem eigenen Alltag finden, in denen es zur Anwendung kam und kommt. Ein Lehrbuchbeispiel ist der Fall einer jungen Frau in New York vor einigen Jahrzehnten, die vor den Augen von 38 Zeugen ermordet wurde. Keiner der Zeugen, die die Tat vom Fenster ihrer Wohnung aus beobachten konnten, leistete Hilfe oder griff auch nur zum Telefon, um die Polizei zu rufen.
Die Fachwelt spricht von Verantwortungsdiffusion, wenn - wie in diesem tragischen Fall - jeder Zeuge eines Vorfalls von einem anderen Beobachter erwartet, dass dieser sich die Mühe macht, Hilfe zu leisten. Anders ausgedrückt: "Je größer die Zahl der Zuschauer (n) in einer Hilfeleistungssituation, desto geringer ist die (individuelle) Wahrscheinlichkeit (p), dass eine bestimmte Person Hilfe leistet."
Diese Je-desto-Hypothese wurde in zahlreichen experimentellen Settings geprüft und gilt bislang als unwiderlegt. Im sogenannten "Freiwilligendilemma" wurde sie auch von Vertretern der Spieltheorie aufgegriffen und verallgemeinert. Neben der Gruppengröße n, die wir schon oben erwähnt haben, führt die Spieltheorie noch die Faktoren U für den kollektiven Wert der Tätigkeit und K für die (individuellen) Kosten an. Die zugehörige mathematische Formel des spieltheoretischen Modells erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Die (experimentell reproduzierbare) Kernaussage ist jedenfalls: Die Wahrscheinlichkeit der Kooperation steigt mit dem Wert U, sinkt mit den Kosten K und mit der Gruppengröße n.
Vielleicht lässt sich diese Formel auch mit Gewinn auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihren Umgang mit Schutz suchenden Menschen anwenden?
Welche "mamihlapinatapai"-Situationen fallen Ihnen ein?
Rufen Sie mich an!
+43 660 34 09 471
Literatur: Diekmann, Andreas. 2010. Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt
Österreich im Stiegenhaus?

„Eine Schichtungsgesellschaft erhebt den Anspruch, jedem Gesellschaftsmitglied den Erwerb des Status zu ermöglichen, der ihm nach seiner Leistung gebührt [im Gegensatz zur Klassengesellschaft, ständischen Gesellschaft oder dem Kastenwesen; PH].“ (Hradil 2006, S. 212)
Anfang des Wintersemesters 2015/16 zeigte das Institut für Soziologie der Universität Wien die Ausstellung „Österreich im Stiegenhaus“, in der die Österreichische Gesellschaft anhand der sozialen Milieus nach Pierre Bourdieu im Institutsgebäude abgebildet wurde.
Das theoretische Modell der sozialen Schichtung wurde im Treppenhaus und in den Räumlichkeiten des Instituts mit seinen drei Stockwerken sinnlich erfahrbar und begehbar. Soziale Mobilität, also der Wechsel von einer sozialen Position in eine andere, war jedem möglich und – von den Anstrengungen des Stiegensteigens abgesehen – einfach zu erreichen. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität steht am Institut zudem ein Lift zur Verfügung.
Basis für diese Untersuchung waren die Daten der EU-SILC-Befragung 2011 mit dem Sondermodul zur „Sozialen Mobilität“, das intergenerationelle Vergleiche in Bezug auf Bildung und Einkommen ermöglicht. Die Ergebnisse der Untersuchung sind ernüchternd.
Einkommensmobilität
Vor allem in den obersten und untersten Bereichen der Einkommensverteilung stellen die AutorInnen eine geringe Mobilität zwischen den Generationen fest. Ging es den Personen in ihrer Jugend finanziell gut, blieb dies auch im Erwachsenenalter überwiegend so. Demgegenüber blieben jene, die in der Jugend ein sehr schwieriges Auskommen hatten, auch später überdurchschnittlich oft im untersten Einkommensfünftel. Kurz gesagt: „Je besser das Auskommen mit dem Haushaltseinkommen im Elternhaushalt war, desto höher ist auch der aktuelle Verdienst.“ (ebd., S. 50).
Bildungsmobilität
Auch in Bezug auf die Bildung der Kinder konstatieren die AutorInnen einen deutlichen Zusammenhang mit dem finanziellen Auskommen in der Jugend. Je besser die Lebenssituation der Befragten mit 14 Jahren war, desto höher war ihr erreichter Bildungsabschluss.
Nicht nur die finanzielle Situation, auch der Bildungsstand der Eltern selbst beeinflusst den Bildungsverlauf junger Menschen deutlich: mehr als die Hälfte (54%) der Kinder aus Akademikerfamilien, aber nur 6% der Kinder aus niedrigen Bildungsschichten erlangen einen Universitätsabschluss.
Zwar stellt die Statistik Austria langfristig einen Anstieg des Bildungsniveaus in Österreich fest, jedoch betrifft diese Zunahme nicht alle Personen gleichermaßen. Vor allem junge Menschen aus bildungsfernen Schichten profitieren weniger von diesem allgemeinen Bildungsanstieg. Unter diesen sind es wiederum Frauen und MigrantInnen, die geringere Chancen auf Aufwärtsmobilität haben.
Österreich im Stiegenhaus?
Sowohl in Hinblick auf die ökonomische Situation als auch auf die Bildung zeigen Altzinger et al., dass in Österreich eher geringe Chancen auf soziale Mobilität bestehen. Das soziale Stiegenhaus, um die Metapher der Ausstellung nochmals heranzuziehen, bleibt vor allem Personen im untersten (und obersten) Stockwerk weitgehend versperrt.
Wie ließe sich der Anspruch auf leistungsgerechten Status verwirklichen? Reden wir darüber!
----
Altzinger, Wilfried, Nadja Lamei, Bernhard Rumplmaier und Alyssa Schneebaum. 2013. Intergenerationelle soziale Mobilität in Österreich. Statistische Nachrichten 1/2013:48-62.
http://epub.wu.ac.at/3778/1/Lebens-Intergen_Mobilität_01_13.pdf (Zugegriffen: 13.1.2016)
Hradil, Stefan. 2006. Soziale Ungleichheit, soziale Schichtung und Mobilität. In: Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie. Hrsg. Hermann Korte und Bernhard Schäfers, 205-227. 6. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Institut für Soziologie, Universität Wien. 2015. Österreich im Stiegenhaus. https://www.soz.univie.ac.at/home/archiv/fakultaetstag-2015/oesterreich-im-stiegenhaus (Zugegriffen: 3.2.2016)
Statistik Austria. 2016. Bildungsstand der Bevölkerung. Entwicklung des Bildungsstandes. http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/bildungsstand_der_bevoelkerung/index.html (Zugegriffen: 21.1.2016)
Das theoretische Modell der sozialen Schichtung wurde im Treppenhaus und in den Räumlichkeiten des Instituts mit seinen drei Stockwerken sinnlich erfahrbar und begehbar. Soziale Mobilität, also der Wechsel von einer sozialen Position in eine andere, war jedem möglich und – von den Anstrengungen des Stiegensteigens abgesehen – einfach zu erreichen. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität steht am Institut zudem ein Lift zur Verfügung.
Doch wie sieht es in der Österreichischen Gesellschaft wirklich aus?
Diese Frage stellte ich mir im Jänner Rahmen einer kleinen Proseminar-Arbeit. Auf der Seite der Statistik Austria fand ich unter anderem einen Artikel, der die Intergenerationelle soziale Mobilität In Österreich behandelt, sprich: „die Fähigkeit der Mitglieder einer jüngeren Generation, im Vergleich zu ihren Eltern eine andere Position in der Gesellschaft zu erreichen.“ (Altzinger et al. 2013, S. 48)Basis für diese Untersuchung waren die Daten der EU-SILC-Befragung 2011 mit dem Sondermodul zur „Sozialen Mobilität“, das intergenerationelle Vergleiche in Bezug auf Bildung und Einkommen ermöglicht. Die Ergebnisse der Untersuchung sind ernüchternd.
Einkommensmobilität
Vor allem in den obersten und untersten Bereichen der Einkommensverteilung stellen die AutorInnen eine geringe Mobilität zwischen den Generationen fest. Ging es den Personen in ihrer Jugend finanziell gut, blieb dies auch im Erwachsenenalter überwiegend so. Demgegenüber blieben jene, die in der Jugend ein sehr schwieriges Auskommen hatten, auch später überdurchschnittlich oft im untersten Einkommensfünftel. Kurz gesagt: „Je besser das Auskommen mit dem Haushaltseinkommen im Elternhaushalt war, desto höher ist auch der aktuelle Verdienst.“ (ebd., S. 50).
Bildungsmobilität
Auch in Bezug auf die Bildung der Kinder konstatieren die AutorInnen einen deutlichen Zusammenhang mit dem finanziellen Auskommen in der Jugend. Je besser die Lebenssituation der Befragten mit 14 Jahren war, desto höher war ihr erreichter Bildungsabschluss.
Nicht nur die finanzielle Situation, auch der Bildungsstand der Eltern selbst beeinflusst den Bildungsverlauf junger Menschen deutlich: mehr als die Hälfte (54%) der Kinder aus Akademikerfamilien, aber nur 6% der Kinder aus niedrigen Bildungsschichten erlangen einen Universitätsabschluss.
Zwar stellt die Statistik Austria langfristig einen Anstieg des Bildungsniveaus in Österreich fest, jedoch betrifft diese Zunahme nicht alle Personen gleichermaßen. Vor allem junge Menschen aus bildungsfernen Schichten profitieren weniger von diesem allgemeinen Bildungsanstieg. Unter diesen sind es wiederum Frauen und MigrantInnen, die geringere Chancen auf Aufwärtsmobilität haben.
Österreich im Stiegenhaus?
Sowohl in Hinblick auf die ökonomische Situation als auch auf die Bildung zeigen Altzinger et al., dass in Österreich eher geringe Chancen auf soziale Mobilität bestehen. Das soziale Stiegenhaus, um die Metapher der Ausstellung nochmals heranzuziehen, bleibt vor allem Personen im untersten (und obersten) Stockwerk weitgehend versperrt.
Wie ließe sich der Anspruch auf leistungsgerechten Status verwirklichen? Reden wir darüber!
+43 660 34 09 471
----
Altzinger, Wilfried, Nadja Lamei, Bernhard Rumplmaier und Alyssa Schneebaum. 2013. Intergenerationelle soziale Mobilität in Österreich. Statistische Nachrichten 1/2013:48-62.
http://epub.wu.ac.at/3778/1/Lebens-Intergen_Mobilität_01_13.pdf (Zugegriffen: 13.1.2016)
Hradil, Stefan. 2006. Soziale Ungleichheit, soziale Schichtung und Mobilität. In: Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie. Hrsg. Hermann Korte und Bernhard Schäfers, 205-227. 6. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Institut für Soziologie, Universität Wien. 2015. Österreich im Stiegenhaus. https://www.soz.univie.ac.at/home/archiv/fakultaetstag-2015/oesterreich-im-stiegenhaus (Zugegriffen: 3.2.2016)
Statistik Austria. 2016. Bildungsstand der Bevölkerung. Entwicklung des Bildungsstandes. http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/bildungsstand_der_bevoelkerung/index.html (Zugegriffen: 21.1.2016)
Warum Soziologie? – Eine erste Annäherung

Sommer 1986. Ich war gerade siebzehn Jahre alt geworden und trat meinen ersten „richtigen“ Ferienjob an. Die Jahre davor hatte ich in der Firma meines Vaters gejobbt, also in einer sehr beschützten Position. Nun wollte ich wissen, wie es in der großen, weiten Arbeitswelt „da draußen“ aussah.
Ich hatte im Lager eines großen Buchversandhandels angeheuert und pendelte nun jeden Tag frühmorgens an Stadtrand, um dort für 38 Schilling pro Stunde Bücher zu verpacken und für den Versand vorzubereiten.
An guten Tagen konnte ich durch die Gänge laufen und die bestellten Waren zusammensuchen und in die Versandabteilung bringen. Oder im Büro Briefe und Rechnungen kuvertieren. An schlechten Tagen stand ich am Fließband.
Dort zogen unterschiedlich große Häufchen von Büchern in enormem Tempo an mir vorbei. Meine Aufgabe bestand darin, die Häufchen in bereitgestellte Faltkartons zu packen, und zwar möglichst bevor sie im alles verzehrenden Schlund der Verschnürungsmaschine verschwanden.
Sie können sich vorstellen, dass ich das Fließband anfangs häufig per Notknopf abschalten musste, um nicht zu riskieren, dass meine Pappschachtel faltenden Hände gleich mitverschnürt würden. Das Band war einfach viel zu schnell für mich.
Eingeschult und überwacht wurde ich dabei von einer jungen Frau, etwa in meinem Alter. Anfangs war die Stimmung eher eisig. Zum einen wurden wir FerialpraktikantInnen ohnedies von allen schief angesehen. Zum anderen war aber meine Ungeschicklichkeit und Langsamkeit auch indirekt dafür verantwortlich, dass sie ein schlechteres Ergebnis bei dieser Akkordarbeit erzielte.
Mit der Zeit wurde ich schneller, und nach etwa einer Woche konnte ich schon mit der Maschine mithalten. Das war der Moment, an der sie mich einlud, mit ihr gemeinsam eine Zigarettenpause zu machen. Seit diesem Tag unterhielten wir uns immer wieder miteinander, und sie erzählte mir von ihrem alkoholkranken Vater, ihrem arbeitslosen älteren Bruder (oder war es umgekehrt?) und von den kleinen Geschwistern, die sie unterstützen musste.
Denn anders als ich arbeitete sie nicht nur in den Ferien dort. Es war ihr Beruf, und zwar schon seit dem Ende ihrer Schulpflicht. Und würde es auch bleiben, zumindest für die absehbare Zukunft. Was sollte sie schon anderes tun? Ihre größte Hoffnung war, ihren kleinen Geschwistern eine bessere Ausbildung finanzieren zu können. Für sich selbst hatte sie keine großen Pläne.
Ich selbst war bis dahin wohl behütet, in einem sicheren Wohnbezirk fernab aller sozialer Missstände aufgewachsen. Das war eine fremde Welt für mich. Und diese Welt war ungerecht. Während ich wusste, dass ich nach einem Monat bei der Firma wieder zur Schule gehen und ein Jahr später maturieren würde, steckte sie dort fest.
Das war der Sommer, in dem mein soziales Bewusstsein erwachte. Der Sommer, in dem mein bisheriges Weltbild erschüttert und über den Haufen geworfen wurde. Der Sommer, der meine politische Einstellung nachhaltig veränderte.
Und auf gewisse Weise könnte man sagen, dass dieser Sommer und vor allem die Kollegin, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere, mit dafür verantwortlich sind, dass ich jetzt, fast dreißig Jahre später, Soziologie studiere. Ich hoffe, sie hat trotz widriger Ausgangsbedingungen ihren Weg gemacht und heute ein gutes Leben. Und ihre kleinen Geschwister auch. Das wünsche ich mir zu Weihnachten.
Ihr und Ihnen allen wünsche ich darüber hinaus
An guten Tagen konnte ich durch die Gänge laufen und die bestellten Waren zusammensuchen und in die Versandabteilung bringen. Oder im Büro Briefe und Rechnungen kuvertieren. An schlechten Tagen stand ich am Fließband.
Dort zogen unterschiedlich große Häufchen von Büchern in enormem Tempo an mir vorbei. Meine Aufgabe bestand darin, die Häufchen in bereitgestellte Faltkartons zu packen, und zwar möglichst bevor sie im alles verzehrenden Schlund der Verschnürungsmaschine verschwanden.
Sie können sich vorstellen, dass ich das Fließband anfangs häufig per Notknopf abschalten musste, um nicht zu riskieren, dass meine Pappschachtel faltenden Hände gleich mitverschnürt würden. Das Band war einfach viel zu schnell für mich.
Eingeschult und überwacht wurde ich dabei von einer jungen Frau, etwa in meinem Alter. Anfangs war die Stimmung eher eisig. Zum einen wurden wir FerialpraktikantInnen ohnedies von allen schief angesehen. Zum anderen war aber meine Ungeschicklichkeit und Langsamkeit auch indirekt dafür verantwortlich, dass sie ein schlechteres Ergebnis bei dieser Akkordarbeit erzielte.
Mit der Zeit wurde ich schneller, und nach etwa einer Woche konnte ich schon mit der Maschine mithalten. Das war der Moment, an der sie mich einlud, mit ihr gemeinsam eine Zigarettenpause zu machen. Seit diesem Tag unterhielten wir uns immer wieder miteinander, und sie erzählte mir von ihrem alkoholkranken Vater, ihrem arbeitslosen älteren Bruder (oder war es umgekehrt?) und von den kleinen Geschwistern, die sie unterstützen musste.
Denn anders als ich arbeitete sie nicht nur in den Ferien dort. Es war ihr Beruf, und zwar schon seit dem Ende ihrer Schulpflicht. Und würde es auch bleiben, zumindest für die absehbare Zukunft. Was sollte sie schon anderes tun? Ihre größte Hoffnung war, ihren kleinen Geschwistern eine bessere Ausbildung finanzieren zu können. Für sich selbst hatte sie keine großen Pläne.
Ich selbst war bis dahin wohl behütet, in einem sicheren Wohnbezirk fernab aller sozialer Missstände aufgewachsen. Das war eine fremde Welt für mich. Und diese Welt war ungerecht. Während ich wusste, dass ich nach einem Monat bei der Firma wieder zur Schule gehen und ein Jahr später maturieren würde, steckte sie dort fest.
Das war der Sommer, in dem mein soziales Bewusstsein erwachte. Der Sommer, in dem mein bisheriges Weltbild erschüttert und über den Haufen geworfen wurde. Der Sommer, der meine politische Einstellung nachhaltig veränderte.
Und auf gewisse Weise könnte man sagen, dass dieser Sommer und vor allem die Kollegin, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere, mit dafür verantwortlich sind, dass ich jetzt, fast dreißig Jahre später, Soziologie studiere. Ich hoffe, sie hat trotz widriger Ausgangsbedingungen ihren Weg gemacht und heute ein gutes Leben. Und ihre kleinen Geschwister auch. Das wünsche ich mir zu Weihnachten.
Ihr und Ihnen allen wünsche ich darüber hinaus
erholsame Feiertage und ein glückliches Neues Jahr!
Ein folgenreicher Irrtum

Photo © Tamorlan
Romeo und Julia hätten nicht sterben müssen. Warum die Tragödie dennoch ihren Lauf nahm, erklärt ein weiterer Klassiker aus den von mir schon einmal zitierten „Sternstunden der Soziologie“:
Das Thomas-Theorem
Thomas und Thomas: Die Definition der Situation„If men define situations as real, they are real in their consequences“, schreiben William I. Thomas und seine Frau Dorothy Swaine Thomas in ihrer 1928 veröffentlichten Studie „The Child in America“. Und meinen damit, um ein Verhalten oder Fehlverhalten analysieren und einschätzen zu können, müsse man nicht nur die objektive Situation betrachten, sondern auch miteinbeziehen, wie die AkteurInnen diese Situation selbst deuten. Diese Definitionen der Situation mögen zwar weit von der Wirklichkeit entfernt sein, haben aber dennoch Auswirkungen auf die Handelnden und ihre Entscheidungen, und nur im Lichte dieser subjektiven Wirklichkeiten könne man ihre Handlungen beurteilen.
Ana Mijic, die die Einführung zu diesem Text verfasst hat, bringt dazu folgendes Beispiel: Romeo und Julia werden bekanntlich von ihren Familien daran gehindert werden, ein Paar zu werden. Durch Vortäuschung ihres Todes mittels eines Schlaftrunks will Julia der Zwangsehe mit einem anderen Mann entgehen. Romeo, der von dieser List nichts weiß, hält sie für wirklich tot und bringt sich um. Da erwacht Julia aus ihrem Schlaf, sieht den toten Geliebten und macht ihrem Leben mit seinem Dolch ein Ende. Fazit: Beide tot, und das nur, weil Romeo die Situation falsch eingeschätzt hat.
Gut, denken Sie vielleicht, das ist ein Extrembeispiel, und noch dazu ein Literarisches. Dennoch: Das Prinzip dahinter gilt, wie Thomas und Thomas herausgefunden haben, in vielen Situationen. Vor allem hinter abweichendem Verhalten oder Auseinandersetzungen stehen häufig Diskrepanzen in den Situationsdefinitionen der AkteurInnen. Oft kann es daher hilfreich sein sich, bevor ein Streit eskaliert, über die wechselseitigen Deutungen auszutauschen.
Coaching und Mediation könne die wechselseitige Situationsdeutung begleiten und unterstützen. Rufen Sie mich an!
+43 660 34 09 471
Quelle: Mijic, Ana. 2010. Glaube kann Berge versetzen. In: Sternstunden der Soziologie. Wegweisende Theoriemodelle des soziologischen Denkens. Hrsg. Sighard Neckel, Ana Mijic, Christian von Scheve und Monica Titton, 21-28. New York: Campus-Verlag.
Der „Veblen-Effekt“: Teuer = Gut (Teil 2)

Sie erinnern sich vielleicht: schon vor einiger Zeit hatte ich Ihnen von dem eigenartigen Phänomen erzählt, dass Kunden eine Ware erst kauften, nachdem der Preis verdoppelt worden war. Robert Cialdini erklärte dies damit, dass wir in unseren Köpfen eine Urteilsheuristik, also eine Entscheidungsabkürzung, gespeichert haben, die da lautet: teuer = gut. Doch wie kommt die da hinein? Was sind die Hintergründe?
Eine Theorie, auf die ich im Zuge meines Soziologie-Studiums nun gestoßen bin, könnte Licht in diese Sache bringen. Sie wurde vom amerikanischen Soziologen Thorstein Veblen in seiner „Theorie der feinen Leute“ bereits 1899 veröffentlicht. Um sie zu verstehen, müssen wir gemeinsam eine Reise in die Vergangenheit unternehmen.
Veblen setzt in seinen Ausführungen zwar schon etwas früher an, aber für uns genügt es, in die Zeit kurz vor der industriellen Revolution zu reisen. Nach den zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen des Mittelalters, herrschen nun schon seit einiger Zeit Frieden und Wohlstand. Vor allem natürlich am Hof der Aristokratie, der wir nun einen kleinen Besuch abstatten.
Die Elite jener Tage hatte Geld wie Heu und Zeit ohne Ende. Die Arbeit wurde von anderen erledigt. Um diesen Luxus auch gebührend darzustellen, übten sie sich in uneingeschränktem Konsum und „demonstrativem Müßiggang“. Sie kauften die teuersten Güter, entwickelten einen exklusiven Geschmack und Differenzierungsvermögen und kultivierten die „guten Sitten.“
„Ein Leben in Muße muss in angemessener Weise geführt werden; dieser Überzeugung verdanken wir die guten Manieren.“ (Veblen, 1899)
Das Vermögen wuchs weiter an, und die oberen Klassen konnten ihren Reichtum nicht mehr selbst angemessen durch Prestigekonsum und Müßiggang zeigen. Sie übertrugen einen Teil dieser „Leistung“ auf Angestellte und Leibeigene. Auf diese Weise entstand der „stellvertretende Konsum“ der Untergebenen.
Parallel dazu, und nun nähern wir uns wieder unserem eigentlichen Thema, begannen auch die mittleren und unteren Gesellschaftsschichten, sich an den Lebensweisen der Oberklasse zu orientieren und sich selbst in demonstrativem Konsum und – in dem Maße, in dem dies möglich war – Müßiggang zu üben. Die Konsummuster der Elite dienten dabei als Vorbild und Norm für sämtliche übrigen Schichten.
Mit dem gesellschaftlichen Wandel der Industrialisierung und Verstädterung, verlor der „demonstrative Müßiggang“ an Bedeutung. Prestigewert besaß er ja nur insofern, als er auch von anderen wahrgenommen wurde, und in der Anonymität der Stadt mit ihren flüchtigen Begegnungen war dies ungleich schwieriger als in klein strukturierten Gesellschaften. Um den Wohlstand möglichst unmittelbar zu zeigen, spielte der Konsum eine immer größere Rolle. Der Prestigewert der Ware gewann an Gewicht.
Und damit kommen wir wieder in unserer Zeit an. Auch heute noch – oder vielleicht gerade heute – orientieren wir uns in unserem Konsumverhalten nicht ausschließlich am objektiven Nutzen der Güter. Unser Impuls, zu exklusiven, teuren Waren zu greifen, erklärt sich nach Veblen an einer anderen Art von Wert: dem symbolischen Wert der Dinge. Wir kaufen, um anderen etwas zu zeigen. Ob dies nun unser Reichtum, unsere Unangepasstheit, unsere Zugehörigkeit zu einer Gruppe, unsere „Individualität“ sei: Immer schwingt dieser Symbolwert, dieses Signal an andere, mit und bestimmt unser Kaufverhalten.
In seiner „Theorie der feinen Leute“ widersprach Veblen den klassischen ökonomischen Theorien zum Nachfrageverhalten seiner Zeit. Seine Beobachtungen sind heute als „Veblen-Effekte“ bekannt:
Möchten Sie über die Gründe Ihres eigenen Konsumverhaltens nachdenken? Dann rufen Sie mich an!
Quelle: Von Scheve, Christian. 2010. Hauptsache teuer! – Thorstein Veblen: Der demonstrative Konsum. In: In: Neckel, Sighard, Mijic, Ana, von Scheve, Christian und Titton, Monica (Hrsg.). Sternstunden der Soziologie. Wegweisende Theoriemodelle des soziologischen Denkens. New York: Campus-Verlag; 423-447.
Veblen setzt in seinen Ausführungen zwar schon etwas früher an, aber für uns genügt es, in die Zeit kurz vor der industriellen Revolution zu reisen. Nach den zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen des Mittelalters, herrschen nun schon seit einiger Zeit Frieden und Wohlstand. Vor allem natürlich am Hof der Aristokratie, der wir nun einen kleinen Besuch abstatten.
Die Elite jener Tage hatte Geld wie Heu und Zeit ohne Ende. Die Arbeit wurde von anderen erledigt. Um diesen Luxus auch gebührend darzustellen, übten sie sich in uneingeschränktem Konsum und „demonstrativem Müßiggang“. Sie kauften die teuersten Güter, entwickelten einen exklusiven Geschmack und Differenzierungsvermögen und kultivierten die „guten Sitten.“
„Ein Leben in Muße muss in angemessener Weise geführt werden; dieser Überzeugung verdanken wir die guten Manieren.“ (Veblen, 1899)
Das Vermögen wuchs weiter an, und die oberen Klassen konnten ihren Reichtum nicht mehr selbst angemessen durch Prestigekonsum und Müßiggang zeigen. Sie übertrugen einen Teil dieser „Leistung“ auf Angestellte und Leibeigene. Auf diese Weise entstand der „stellvertretende Konsum“ der Untergebenen.
Parallel dazu, und nun nähern wir uns wieder unserem eigentlichen Thema, begannen auch die mittleren und unteren Gesellschaftsschichten, sich an den Lebensweisen der Oberklasse zu orientieren und sich selbst in demonstrativem Konsum und – in dem Maße, in dem dies möglich war – Müßiggang zu üben. Die Konsummuster der Elite dienten dabei als Vorbild und Norm für sämtliche übrigen Schichten.
Mit dem gesellschaftlichen Wandel der Industrialisierung und Verstädterung, verlor der „demonstrative Müßiggang“ an Bedeutung. Prestigewert besaß er ja nur insofern, als er auch von anderen wahrgenommen wurde, und in der Anonymität der Stadt mit ihren flüchtigen Begegnungen war dies ungleich schwieriger als in klein strukturierten Gesellschaften. Um den Wohlstand möglichst unmittelbar zu zeigen, spielte der Konsum eine immer größere Rolle. Der Prestigewert der Ware gewann an Gewicht.
Und damit kommen wir wieder in unserer Zeit an. Auch heute noch – oder vielleicht gerade heute – orientieren wir uns in unserem Konsumverhalten nicht ausschließlich am objektiven Nutzen der Güter. Unser Impuls, zu exklusiven, teuren Waren zu greifen, erklärt sich nach Veblen an einer anderen Art von Wert: dem symbolischen Wert der Dinge. Wir kaufen, um anderen etwas zu zeigen. Ob dies nun unser Reichtum, unsere Unangepasstheit, unsere Zugehörigkeit zu einer Gruppe, unsere „Individualität“ sei: Immer schwingt dieser Symbolwert, dieses Signal an andere, mit und bestimmt unser Kaufverhalten.
In seiner „Theorie der feinen Leute“ widersprach Veblen den klassischen ökonomischen Theorien zum Nachfrageverhalten seiner Zeit. Seine Beobachtungen sind heute als „Veblen-Effekte“ bekannt:
- Der Preis einer Ware spiegelt nicht nur deren Wert wieder, sondern muss „an und für sich als sozial bedeutsames Symbol – als „nutzenstiftend“ – betrachtet werden.“
- Konsumenten orientieren sich am Einkaufsverhalten anderer, was zu sogenannten Mitläufer-Effekten führt.
Möchten Sie über die Gründe Ihres eigenen Konsumverhaltens nachdenken? Dann rufen Sie mich an!
+43 660 34 09 471
Quelle: Von Scheve, Christian. 2010. Hauptsache teuer! – Thorstein Veblen: Der demonstrative Konsum. In: In: Neckel, Sighard, Mijic, Ana, von Scheve, Christian und Titton, Monica (Hrsg.). Sternstunden der Soziologie. Wegweisende Theoriemodelle des soziologischen Denkens. New York: Campus-Verlag; 423-447.
Pygmalion im Klassenzimmer

Im Osten Österreichs hat die Schule wieder begonnen. Nicht für alle ist das gleichermaßen erfreulich. Vor allem für jene nicht, die heute noch darum bangen müssen, ob sie überhaupt versetzt werden. Dieser Artikel soll eine Erinnerung für alle LehrerInnen und Trost und Rat für Eltern und SchülerInnen sein.
Pygmalion-Effekt
Der Pygmalion-Effekt ist eine Spezialform der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Entdeckt wurde er von den US-amerikanischen Psychologen Robert Rosenthal und Lenore F. Jacobson 1965. In einem berühmt gewordenen Feldversuch an einer amerikanischen Grundschule täuschten Rosenthal und Jacobson den LehrerInnen vor, einige der SchülerInnen hätten bei einem entsprechenden Test ein besonders hohes Potential gezeigt. Sie stünden vor einem Entwicklungsschub, und im kommenden Schuljahr sei daher mit ganz besonders guten Leistungen von ihnen zu rechnen. Tatsächlich hatte man den IQ der SchülerInnen getestet. Die Einteilung in die Gruppe der "Bloomers" bzw. "Sprinters" erfolgte allerdings nach dem Zufallsprinzip.Acht Monate nach Beginn des Experiments wurden die SchülerInnen einem weiteren IQ Test unterzogen. Nun zeigte sich, dass genau jene 20% aus der "Bloomer"-Gruppe, denen also ein besonders hohes Leistungspotential zugeschrieben worden war, eine weit höhere Steigerungsquote ihres IQ aufwiesen, als die Kontrollgruppe. Sie waren also "intelligenter" geworden! Da mit Ausnahme der Information der Lehrer über das vermeintliche Potenzial der SchülerInnen alle anderen Bedingungen gleich waren, kam als einziger Grund für diese Leistungssteigerung nur die Erwartungshaltung der Lehrenden gegenüber diesen Schülern in Betracht. Die eingangs gemachte Prophezeiung, die ja jeglicher faktischer Grundlage entbehrte, hatte sich erfüllt.
In Erwartung einer besseren Leistung hatten die LehrerInnen diese 20% der SchülerInnen anders behandelt und damit zu einer tatsächlichen Steigerung beigetragen.
Das wirkt zunächst entmutigend. Es scheint, als seien wir bzw. unsere Kinder der Meinung des Lehrenden ausgeliefert, und die weitere Entwicklung hinge nur von dieser Haltung ab. Doch das stimmt nicht ganz. Denn erstens wurde in späteren Untersuchungen festgestellt, dass der Effekt meist nicht ganz so stark wirkt wie von Rosenthal und Jacobson beobachtet. Und zweitens können wir ihn, wenn wir es geschickt anstellen, sogar für uns verwenden, indem wir uns einen weiteren Psychologischen Effekt zunutze machen:
Der Primäreffekt
Der Primäreffekt besagt, dass wir uns an früher eingehende Informationen besser erinnern als an später eingehende Information.Oder im Volksmund: Der erste Eindruck währt am längsten.Wer in den ersten Wochen des Schuljahrs bei einem (neuen) Lehrer besonders positiv auffällt, wird von diesem nachhaltig als guter Schüler betrachtet (Primäreffekt) und als solcher behandelt (Pygmalion-Effekt). Spätere weniger gute Leistungen werden entweder gar nicht bemerkt oder anders bewertet.
Ich habe mich meine gesamte Schulzeit hindurch -- freilich ohne die Effekte beim Namen nennen zu können -- genau so durch einige ungeliebte Fächer durchgemogelt: In den ersten Stunden war ich besonders aufmerksam und schrieb brav mit. Ich meldete mich auch freiwillig zu einer der ersten Stundenwiederholungen. Das war nicht weiter aufwändig, da der Stoff in den ersten Stunden nicht besonders schwierig oder umfangreich war. Hatte ich den September gut überstanden, ließ mein Fleiß schlagartig deutlich nach. Das machte aber gar nichts aus! Der Grundstein war gelegt, und ich konnte ziemlich sicher sein, das Jahr zumindest positiv abzuschließen. Man möchte gar nicht glauben, mit wie wenig Ahnung von Chemie man die Matura schaffen kann :-)
In diesem Sinne wünsche ich allen SchülerInnen einen guten Start ins neue Schuljahr. Und denen, die heute noch eine Nachprüfung ablegen müssen, ganz viel Glück!
Petra Hennrich Creative Coaching
Grafikerin, systemische Coachin, Trainerin, Autorin
Lindengasse 14/3/5, 1070 Wien, Tel.: 0660 34 09 471
» Über mich » Kontakt » Links » Newsletter » Presse
Lindengasse 14/3/5, 1070 Wien, Tel.: 0660 34 09 471
» Über mich » Kontakt » Links » Newsletter » Presse
» Coaching
» Gesellschaft
» Glück
» Kommunikation
» Kreativität
» Leben & Lernen
» Erfolg
» Zeit ist Lebenszeit
» Spielen
» Lachen
» Rezensionen
» Zitate
» Gesellschaft
» Glück
» Kommunikation
» Kreativität
» Leben & Lernen
» Erfolg
» Zeit ist Lebenszeit
» Spielen
» Lachen
» Rezensionen
» Zitate

Hier bestellen:


(admin)